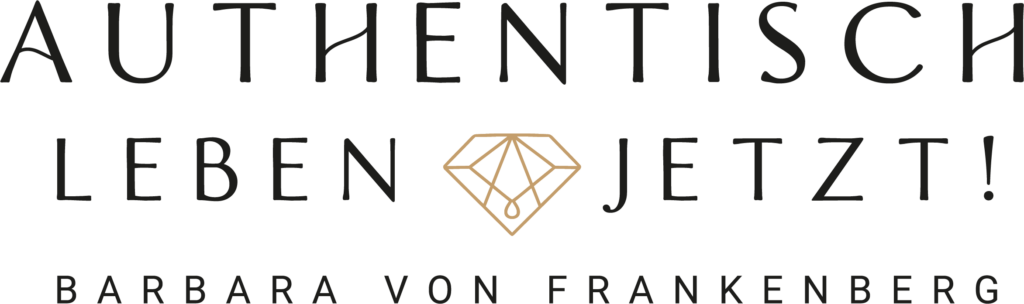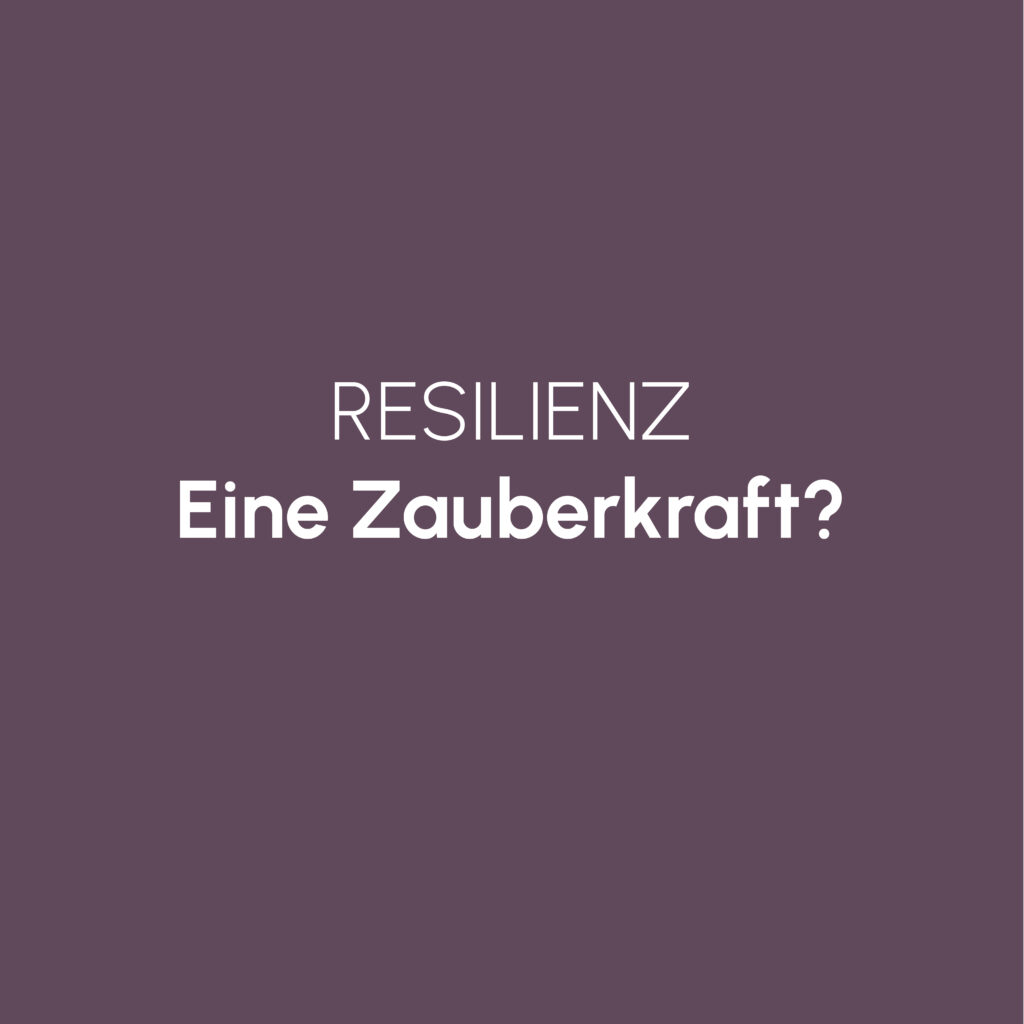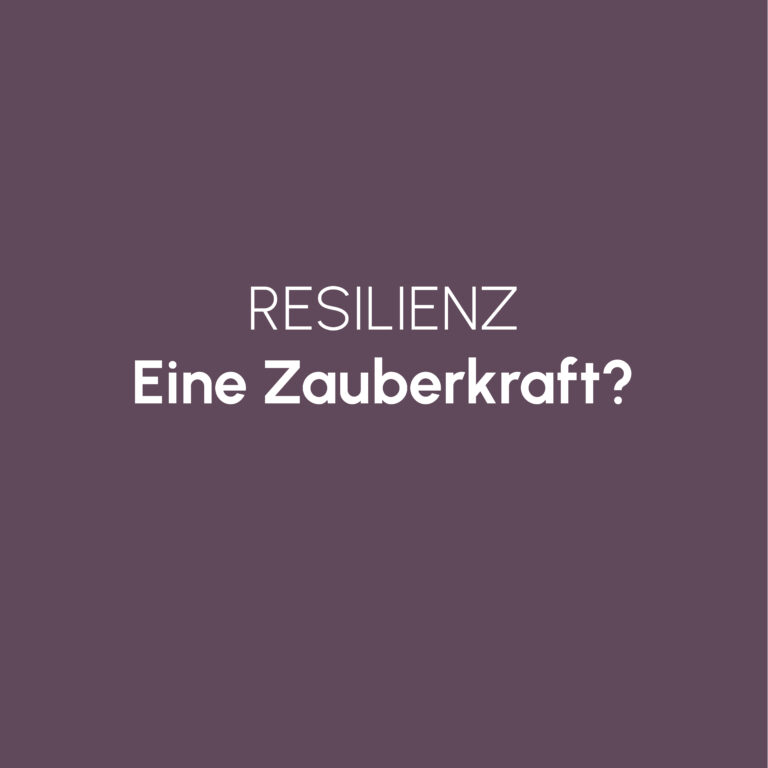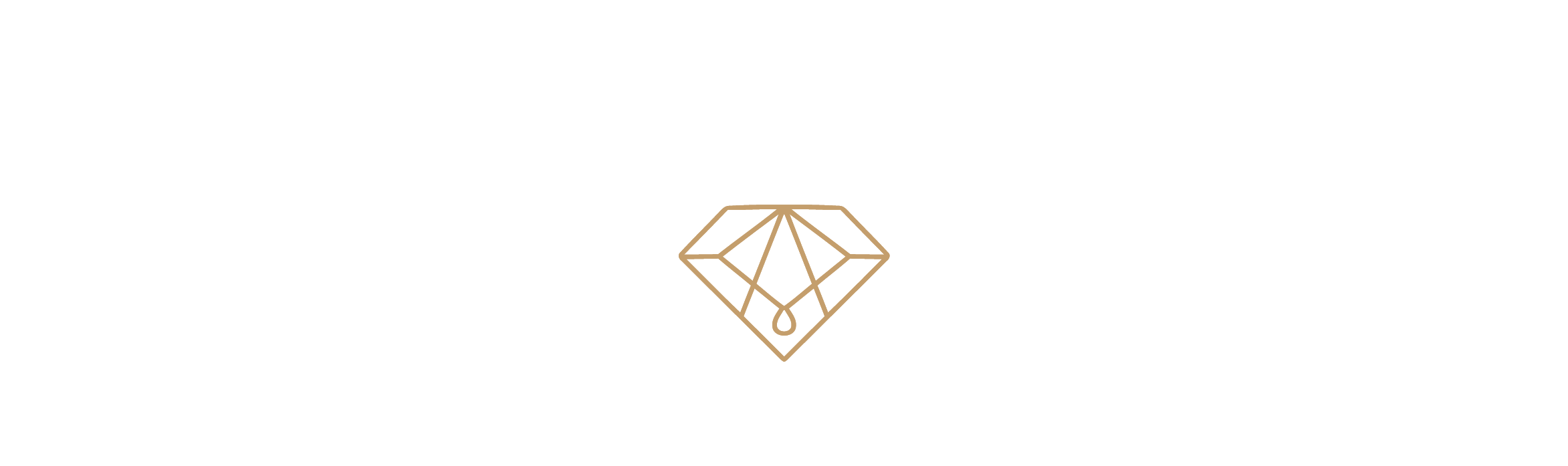Grenzen zu setzen – sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen als auch im beruflichen Kontext – kann eine der schwierigsten, aber auch eine der wertvollsten Fähigkeiten sein.
Es geht dabei nicht nur um das „Nein sagen“, sondern vielmehr um die Wahrung der eigenen Bedürfnisse, Werte und des Wohlbefindens.
Doch warum fällt es vielen Menschen so schwer, klare Grenzen zu ziehen? Und warum ist es eigentlich so wichtig, dies zu tun?
Warum uns das Setzen von Grenzen, Abgrenzung, schwerfällt
Es gibt mehrere Gründe, warum wir das Setzen von Grenzen oft als Herausforderung empfinden. Einer der Hauptgründe ist der Wunsch nach Harmonie. Viele Menschen haben Angst, andere zu enttäuschen oder Konflikte zu verursachen, wenn sie ihre Bedürfnisse und Wünsche kommunizieren oder gar noch durchsetzen. Ob in persönlichen oder beruflichen Beziehungen – das Gefühl ich müsste ständig gefallen, um akzeptiert oder gemocht zu werden, ist sehr schnell sehr präsent.
Dahinter steht oft ein geringer Selbstwert – beziehungsweise die Tatsache, dass wir unseren Selbstwert daran messen, wie sehr wir (vermeintlich) von anderen gemocht werden. Wir machen unseren Selbstwert abhängig von Wohlwollen und Anerkennung im Außen – es fällt sofort auf, dass diese Messlatte nicht klug sein kann – und doch drängt sie sich immer wieder penetrant auf.
Ein weiterer Grund ist die Angst vor Ablehnung oder dem Verlust von Beziehungen. Wer klare Grenzen zieht, befürchtet manchmal, dass dies als Egoismus, Rücksichtslosigkeit oder mangelnde Flexibilität wahrgenommen wird – eine Haltung, die oft zu Selbstzweifeln führt. Die Gesellschaft, also das Kollektiv, eine Gruppe oder auch die Familie betrachtet es oft als unangemessen, individuelle Bedürfnisse über die Bedürfnisse der Gruppe zu stellen und übt diesbezüglich auch gerne mal einen bemerkenswerten Druck auf uns aus. Wir bekommen Angst. Angst vor dem Konflikt, Angst vor Ablehnung, Angst vor Verlust der Zugehörigkeit …
Und dazu kommt – in meinen Augen mit am wichtigsten – dass wir uns oft unserer eigenen Bedürfnisse gar nicht so richtig bewusst sind – wir haben wenig Klarheit darüber, was uns wirklich wichtig ist, was uns entspricht, was korrekt für uns ist und was nicht. Aus verschiedensten Gründen wissen wir nicht genau, was wir wirklich brauchen. Erziehung und Konditionierungen spielen hierbei eine maßgebliche Rolle. Deshalb orientieren wir uns an Erwartungen anderer, mit der Folge, dass unsere eigenen Wünsche ganz verwaschen und verblassen – das alles wegen unserem Bedürfnis, Anerkennung aus dem Außen zu erhalten, um unseren eigenen Selbstwert zu nähren.
Frauen und Männer im Umgang mit Grenzen: Gibt es Unterschiede?
In Diskussionen über das Setzen von Grenzen wird häufig die Frage aufgeworfen, ob Frauen und Männer sich dabei unterschiedlich schwertun. Tatsächlich gibt es in der Wahrnehmung und im Verhalten Unterschiede – wenn auch nicht zwangsläufig in der Fähigkeit an sich.
Mädchen und Frauen wird oft beigebracht, fürsorglich, rücksichtsvoll und empathisch zu sein – was sich negativ auf ihre Fähigkeit auswirken kann, Grenzen zu setzen. Sie sind tendenziell eher geneigt, ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten anderer zurückzustellen. Oftmals fällt es Frauen schwerer, ihre Bedürfnisse und Wünsche durchzusetzen, ohne sich gleichzeitig schuldig zu fühlen oder als unangemessen zu erscheinen.
Männer hingegen sehen sich häufig mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert, die sie dazu anregen, sich durchzusetzen und nicht als „weich“ oder „zu emotional“ zu gelten. In der Folge kann das Setzen von Grenzen bei ihnen weniger mit Selbstfürsorge verbunden sein, sondern eher mit dem Wunsch nach Macht und Kontrolle. Bei Männern kann es in manchen Fällen schwierig sein, zu akzeptieren, dass auch sie Verletzlichkeit zeigen und Grenzen setzen dürfen.
Und natürlich gibt es Gemeinsamkeiten: Männer wie Frauen haben Schwierigkeiten, gesunde Grenzen zu setzen. Ganz besonders dann, wenn sie unter Druck stehen oder wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Verhalten auf Ablehnung stößt. Noch schwieriger wird es, wenn wir uns in Abhängigkeitsverhältnissen befinden – privat oder beruflich, finanziell oder emotional. Dann haben wir oft das Gefühl, dass wir nicht die Freiheit haben, unsere Grenzen zu setzten.
Und ich meine, dass beide Geschlechter gleichermaßen herausgefordert sind, wenn es darum geht, festzustellen, wo ihre wahren Grenzen sind. Was bin ich, was bin ich nicht? Was entspricht mir, was entspricht mir nicht? Wohinter stehe ich aus ganzem Herzen, wohinter nicht? Was tut mir wirklich gut, was nicht? Was mache ich aus Angst oder einem Mangelgefühl heraus, was weil ich es wirklich machen mag?
Macht mich meine Grenze zu dem, was ich bin?
Eine sehr interessante Frage – über die es sich trefflich diskutieren lässt. Nimm sie gerne zu deiner Inspiration.
In aller Kürze: ich meine, meine Grenze, die ich nach außen kommunizierte – in Wort und Tat – ist ein gewichtiger Teil dessen, wie ich von meiner Umwelt wahrgenommen werde. Je wahrhaftiger und somit authentischer ich meine Grenzen kommuniziere, je mehr erlaube ich meiner Umwelt mich wirklich so zu wahrzunehmen, wie ich bin.
Und im Innen – so ganz für mich? Letztendlich: JA! Meine Grenze zeigt mir selbst, wer oder was oder wie ich bin. Und sie zeigt mir ebenso, wer oder wie oder was ich NICHT bin.
Wenn ich den Mut habe, das wirklich anzuerkennen – insbesondere all das, was ich nicht bin – schenke ich mir sehr viel Freiheit – weil ich nicht mehr all das tun muss, was ich meine tun zu müssen, um gut genug, wertvoll, liebenswert, erfolgreich etc. etc. zu sein. Wir haben sehr oft die Tendenz, genau das sein zu wollen, was wir NICHT sind. The grass is always greener on the other side … Aber das kann uns nur in die Überforderung, in den Frust, in die Bitterkeit, in die Wut führen.
Warum Grenzen wichtig sind: Authentizität und Selbstfürsorge
Grenzen zu setzen ist der Schlüssel zu einem authentischen Leben. Wer keine Grenzen kennt oder setzt, lebt schnell in einem Zustand der Überforderung und der Selbstverleugnung. Die ständige Anpassung an die Bedürfnisse anderer führ über kurz oder lang zu Unzufriedenheit, Erschöpfung und dem Verlust des eigenen Selbst.
Grenzen zu setzen bedeutet, sich selbst zu respektieren und seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Es ist eine Form der Selbstfürsorge, die die Grundlage für gesunde Beziehungen und ein erfülltes Leben bildet. Es ist tatsächlich wahre Selbstliebe.
Und ein schöner Effekt ist, dass wir, wenn wir uns selbst erkennen, akzeptieren, respektieren, achten, für uns sorgen und uns selbst lieben genau all das – Erkennen, Akzeptanz, Respekt, Achtsamkeit, Fürsorge, Liebe – den Menschen in unserem Umfeld entgegenbringen können. Wirklich. Authentisch. Aus dem Herzen.
Wer seine Grenzen kennt, kann authentischer und klarer kommunizieren, was er oder sie braucht, um sich wohlzufühlen. Authentizität entsteht dann, wenn man zu sich selbst steht, ohne sich für die eigenen Bedürfnisse zu schämen.
Und auch hier: tun wir das alles für uns selbst, ermöglichen wir genau das auch anderen. Es ist win-win.
Was wir tun können, um besser Grenzen zu setzen
Das Setzen von Grenzen ist eine Fähigkeit, die wir erlernen können. Hier einige Tipps:
1. Selbstreflexion: Der erste Schritt besteht darin, sich der eigenen Bedürfnisse und Wünsche bewusst zu werden. Was tut dir gut? Was überfordert dich? Nimm dir regelmäßig Zeit, um zu reflektieren, was du wirklich brauchst. Und mache das nicht nur mit dem Verstand – fühle wirklich in deinen Körper hinein. Zudem ist hier ein externer Blick oft sehr hilfreich – weil genau in diesem Bereich extrem viel Konditionierung, Glaubenssätze und anerzogene Verhaltensmuster sitzen, was man alleine oft nicht gut entdecken kann, weil die gut versteckt sitzen und wirken.
2. Klar kommunizieren: Ein klarer, respektvoller Ausdruck deiner Bedürfnisse ist entscheidend. Oft reicht ein einfaches „Ich brauche eine Pause“ oder „Ich habe genug für heute“ aus. Es ist wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, dich rechtfertigen zu müssen. Die Rechtfertigung käme schon wieder aus der Angst – insofern ist das ein guter Indikator: habe ich das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen?
3. Nein sagen lernen: Nein zu sagen, ist keine Unhöflichkeit, sondern ein Akt der Selbstachtung. Beginne, „Nein“ in kleinen Situationen zu üben, zum Beispiel, wenn du nicht in einer Besprechung bleiben möchtest oder ein ungünstiges Angebot ablehnen musst.
4. Konsistenz: Grenzen setzen ist nicht nur eine einmalige Aktion, sondern ein fortlaufender Prozess. Es ist wichtig, konsequent zu bleiben und deine Grenzen regelmäßig zu überprüfen und zu „verteidigen“.
5. Achtsamkeit: Achte darauf, wie du dich nach bestimmten Interaktionen fühlst. Fühlst du dich gestresst oder ausgelaugt, weil du deine Grenzen nicht klar gesetzt hast? Mit der Zeit wirst du lernen, die Signale deines Körpers besser zu lesen und rechtzeitig zu handeln.
Grenzen setzen für mehr Authentizität und Wohlbefinden
Grenzen zu setzen ist kein Akt der Selbstsucht, sondern ein Akt der Selbstachtung, Selbstfürsorge und Selbstliebe. Es ermöglicht uns, authentisch zu leben, uns vor Überforderung zu schützen und gesunde, respektvolle Beziehungen zu führen. Männer und Frauen kämpfen oft mit ähnlichen Herausforderungen, aber beide können lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu respektieren. Indem wir lernen, klare Grenzen zu setzen, schaffen wir Raum für Selbstfürsorge und ein erfülltes Leben, das im Einklang mit unseren eigenen Werten und Bedürfnissen steht.
Zudem entsteht eine Win-win-Situation für alle Involvierten – weil wir mit unserem Verhalten andere ermuntern und ermutigen, es uns gleich zu tun. Das alles in gegenseitigen Respekt gelebt, kreiert einen Raum, in dem sich jeder und jede authentisch entfalten kann. Und das ist richtig toll.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Wenn du jetzt mit diesem Experiment „Ich setzte meine Grenzen“ anfängst: wundere dich nicht, wenn du erst einmal auf Widerstand in deiner Umgebung stößt – das ist ganz normal. Weil: Du hast dein Umfeld anders „erzogen“ – sie kennen diese Grenzen von dir nicht, sind natürlich bislang davon ausgegangen, dass das alles irgendwie schon für dich in Ordnung ist. Deshalb kann gut sein, dass sie sich vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn du auf einmal anders „funktionierst“ (dein Chef, deine Familie, deine Freunde).
Deshalb mein Tipp: Gib dir und den anderen etwas Zeit, fange mit kleinen Dingen an oder suche das offene, klärende Gespräch. Dabei wäre wichtig, dass du dich nicht rechtfertigst. Und natürlich: wenn du Unterstützung brauchst, lass es mich gerne wissen.